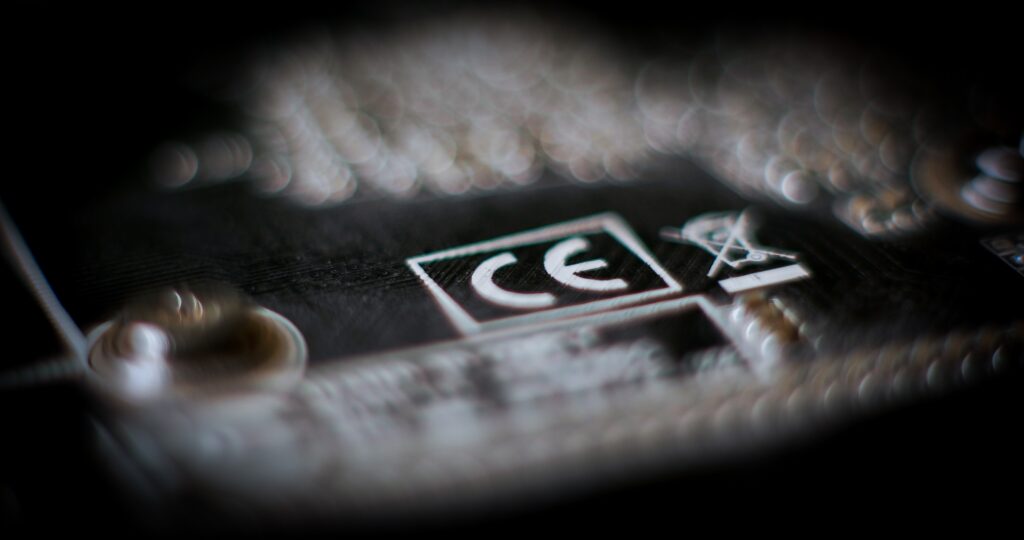- Start
- Inhalt
- Grundlagen des Imports: Rechtlicher Rahmen & wichtige Begriffe
- Der Importprozess Schritt-für-Schritt: Von der EORI-Nummer bis zur Freigabe
- Kosten & Abgaben im Detail: So kalkulieren Sie Zölle und Steuern richtig
- Das größte Risiko: Persönliche Haftung für Geschäftsführer und Importeure
- Strategien zur Risikominimierung: Compliance sichern & Prozesse optimieren
- Intern abwickeln oder externen Partner beauftragen? Eine Entscheidungshilfe
- Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Warenimport
- Fazit: Machen Sie Ihren Import zur sicheren Erfolgsgeschichte

Die Einfuhr von Waren aus Drittländern ist eine enorme Chance für den deutschen Mittelstand, birgt aber komplexe Risiken. Viele Geschäftsführer fürchten undurchsichtige Bürokratie, unkalkulierbare Kosten und vor allem die persönliche Haftung bei Fehlern in der Zollabwicklung. Dieser Leitfaden nimmt Ihnen diese Sorge. Er ist mehr als eine reine Anleitung – er ist Ihr juristischer Kompass für einen rechtssicheren und wirtschaftlich erfolgreichen Importprozess.
Geschrieben von den Zollrecht-Anwälten von O&W, bringen wir unsere 39 Jahre Erfahrung ein, um Ihnen nicht nur den Prozess zu erklären, sondern Sie vor den typischen und oft teuren Fallstricken zu schützen. Sie lernen, den Importprozess Schritt für Schritt zu meistern, alle Kosten transparent zu kalkulieren und, am wichtigsten, die rechtlichen Risiken für sich und Ihr Unternehmen proaktiv zu minimieren.
Grundlagen des Imports: Rechtlicher Rahmen & wichtige Begriffe
Bevor wir in die Praxis einsteigen, müssen wir eine gemeinsame Sprache sprechen. Die Welt des Zolls ist voller spezifischer Begriffe und Gesetze. Wer sie versteht, legt den Grundstein für einen reibungslosen Ablauf.
Abgrenzung: Import aus Drittländern vs. EU-Binnenmarkt
Ein häufiges Missverständnis liegt in der Unterscheidung zwischen einem Import und dem Warenkauf innerhalb der EU. Ein Drittland ist im zollrechtlichen Sinne jeder Staat, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist. Ein Import liegt also nur dann vor, wenn Sie Waren aus einem solchen Land (z. B. China, USA, Großbritannien, Schweiz) nach Deutschland einführen. Der Warenverkehr innerhalb des EU-Binnenmarktes (z. B. ein Kauf in Frankreich oder Polen) wird hingegen als „innergemeinschaftlicher Erwerb“ bezeichnet und unterliegt den deutlich einfacheren Regeln des Umsatzsteuer-Binnenmarktes, aber nicht dem Zollrecht.
Der rechtliche Rahmen: Die wichtigsten Gesetze für Importeure
Das zentrale Regelwerk für jeden Importeur ist der Unionszollkodex (UZK). Er legt EU-weit die Spielregeln für den Warenverkehr mit Drittländern fest. Doch weitere Gesetze spielen eine entscheidende Rolle:
- Außenwirtschaftsgesetz (AWG): Regelt, ob für bestimmte Waren eventuell Einfuhrgenehmigungen oder -beschränkungen gelten.
- Produktsicherheitsgesetz (ProdSG): Überträgt dem Importeur die Verantwortung, dass die eingeführten Produkte sicher sind und den EU-Normen (z. B. CE-Kennzeichnung) entsprechen.
- Verpackungsgesetz (VerpackG): Verpflichtet den Importeur als \“Erstinverkehrbringer\“, sich für importierte Verpackungen an einem dualen System zu beteiligen.
Glossar der Schlüsselbegriffe: Von EORI über ATLAS bis Zolltarifnummer
- EORI-Nummer: Die „Economic Operators Registration and Identification number“ ist eine einzigartige Nummer, die jedes importierende oder exportierende Unternehmen in der EU benötigt. Ohne sie ist keine Zollanmeldung möglich.
- ATLAS-System: Das „Automatisierte Tarif- und Lokale Zoll-Abwicklungs-System“ ist die IT-Plattform der deutschen Zollverwaltung, über die Zollanmeldungen elektronisch eingereicht werden.
- Zolltarifnummer (Warentarifnummer): Diese 8- bis 11-stellige Nummer klassifiziert jede Ware eindeutig. Sie ist die entscheidende Grundlage für die Bestimmung des Zollsatzes, möglicher Einfuhrbeschränkungen und anderer Abgaben.
- Zollwert: Dies ist der Wert der Ware an der Außengrenze der EU. Er ist die Bemessungsgrundlage für den Zoll und setzt sich in der Regel aus dem Warenwert plus den Transport- und Versicherungskosten bis zur EU-Grenze zusammen.
Der Importprozess Schritt-für-Schritt: Von der EORI-Nummer bis zur Freigabe
Der Importprozess folgt einer klaren Logik. Wenn Sie die vier zentralen Schritte kennen, verlieren Bürokratie und Komplexität ihren Schrecken.
Schritt 1: Vorbereitung – Die EORI-Nummer und die richtige Zolltarifnummer
Noch bevor Sie eine Bestellung im Drittland aufgeben, müssen die Hausaufgaben gemacht sein. Beantragen Sie Ihre EORI-Nummer beim Zoll. Dies ist ein einmaliger, kostenloser Prozess.
Noch kritischer ist die Ermittlung der korrekten Zolltarifnummer. Dieses entscheidende Detail bestimmt nicht nur die Höhe der Zölle, sondern auch, ob die Ware überhaupt eingeführt werden darf. Eine falsche Nummer kann zu empfindlichen Nachzahlungen und sogar Strafverfahren führen. Ein gutes Hilfsmittel für die Recherche ist die Datenbank EZT-online der deutschen Zollverwaltung.
Schritt 2: Die entscheidenden Importdokumente beschaffen
Für die Zollanmeldung benötigen Sie einen lückenlosen Satz an Dokumenten. Das wichtigste ist die Handelsrechnung, die alle Pflichtangaben wie Verkäufer, Käufer, Warenbeschreibung, Preis und Lieferbedingung enthalten muss. Ebenso wichtig sind die Frachtpapiere (z. B. Bill of Lading bei Seefracht, AWB bei Luftfracht). Mit einem Ursprungszeugnis oder anderen Präferenznachweisen (z. B. EUR.1) lässt sich nachweisen, dass eine Ware in einem Land hergestellt wurde, mit dem die EU ein Handelsabkommen hat. Dies kann den Zollsatz auf 0 % senken. Je nach Ware können weitere Dokumente wie eine Packliste oder spezifische Zertifikate (z.B. für die CE-Kennzeichnung) erforderlich sein.
Schritt 3: Die Zollanmeldung via ATLAS
Liegen alle Dokumente vor und ist die Ware an der EU-Grenze angekommen, muss die Zollanmeldung über das ATLAS-System erfolgen. Dies kann entweder der Importeur selbst (mit entsprechender Software), ein beauftragter Spediteur oder ein Zollagent übernehmen. In der Anmeldung werden alle relevanten Daten (Absender, Empfänger, Zolltarifnummer, Wert etc.) elektronisch an den Zoll übermittelt. Eine gute Übersicht über den Prozess bietet die offizielle Anleitung zur Zollanmeldung von Germany Trade & Invest (GTAI).
Schritt 4: Die Zollbeschau und die Freigabe der Ware
Nach Eingang der ATLAS-Anmeldung entscheidet das System, ob die Ware direkt freigegeben wird oder eine Prüfung (Zollbeschau) stattfindet. Diese kann eine reine Dokumentenprüfung oder eine physische Kontrolle der Ware sein. Wenn alles in Ordnung ist, erlässt der Zoll den Einfuhrabgabenbescheid, der die Höhe der Zölle und Steuern festlegt. Nach dessen Bezahlung (oder bei Aufschub) wird die Ware zur Einfuhr „überlassen“. Erst jetzt dürfen Sie rechtlich über Ihre Güter verfügen. Eine reibungslose Verzollung dauert oft weniger als 24 Stunden, eine Beschau kann jedoch zu Verzögerungen von mehreren Tagen führen.
Kosten & Abgaben im Detail: So kalkulieren Sie Zölle und Steuern richtig
Die Gesamtkosten eines Imports sind mehr als nur der Einkaufspreis. Eine saubere Kalkulation schützt vor bösen Überraschungen.
Bestandteil 1: Der Zoll – Berechnung anhand von Zollwert und Zolltarifnummer
Die Zollschuld berechnet sich nach einer einfachen Formel: Zoll = Zollwert x Zollsatz. Der Zollwert ist der Wert der Ware inklusive Transportkosten bis zur EU-Grenze. Der Zollsatz ergibt sich aus der Zolltarifnummer.
Beispiel: Sie importieren Ware im Wert von 10.000 € aus den USA. Die Frachtkosten bis Hamburg betragen 1.000 €. Der Zollsatz laut Zolltarifnummer liegt bei 3 %.
Zollwert: 10.000 € + 1.000 € = 11.000 €
Zoll: 11.000 € x 3 % = 330 €
Bestandteil 2: Die Einfuhrumsatzsteuer (EUSt)
Auf jede Einfuhr aus einem Drittland wird die Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) in Höhe des deutschen Umsatzsteuersatzes (aktuell 19 % bzw. 7 %) erhoben. Sie ist nicht mit der normalen Umsatzsteuer zu verwechseln. Die Berechnungsgrundlage ist breiter als beim Zoll: Zollwert + Zollbetrag + Beförderungskosten innerhalb der EU. Der große Vorteil: Vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen können die gezahlte EUSt im Rahmen ihrer regulären Umsatzsteuervoranmeldung als Vorsteuer geltend machen. Sie stellt somit in der Regel nur einen durchlaufenden Posten dar.
Bestandteil 3: Mögliche Zusatzabgaben (Verbrauchsteuern & Antidumpingzölle)
Für bestimmte Waren wie Alkohol, Tabak oder Kaffee fallen zusätzlich Verbrauchsteuern an. Besonders gefährlich und oft übersehen sind Antidumping- und Ausgleichszölle. Diese werden von der EU auf Waren erhoben, die im Verdacht stehen, zu subventionierten oder künstlich niedrigen Preisen auf den Markt gebracht zu werden (z.B. Stahlprodukte, E-Bikes oder Solarmodule aus bestimmten Ländern). Diese Zölle können extrem hoch sein (teilweise über 50 %) und stellen ein erhebliches finanzielles Risiko dar. Eine korrekte Tarifierung der Ware ist daher überlebenswichtig, um nicht unerwartet mit diesen Kosten konfrontiert zu werden.
Das größte Risiko: Persönliche Haftung für Geschäftsführer und Importeure
Über die rein finanziellen Kosten hinaus lauert beim Import ein Risiko, das viele Geschäftsführer unterschätzen: die persönliche Haftung.
Wer haftet bei Fehlern? Die juristische Verantwortung des Importeurs
Grundsätzlich ist immer das importierende Unternehmen der Zollanmelder und damit auch der Zollschuldner. Es ist für die Einhaltung aller Vorschriften verantwortlich. Die kritische Frage für die Unternehmensleitung lautet jedoch: Wann kann die Haftung auf den Geschäftsführer persönlich durchgreifen? Dies geschieht vor allem bei grober Fahrlässigkeit oder Organisationsverschulden. Wenn also im Unternehmen keine klaren Prozesse und Verantwortlichkeiten für den Import definiert sind, kann die Geschäftsführung im Schadensfall persönlich mit ihrem Privatvermögen haftbar gemacht werden – insbesondere bei Steuerhinterziehung, die auch leichtfertig begangen werden kann.
Haftungsfalle 1: Zoll- und Steuerrechtliche Verstöße
Die häufigsten Fehlerquellen sind falsche Zolltarifnummern, ein zu niedrig angegebener Zollwert oder nicht angemeldete Antidumpingzölle. Werden diese Fehler bei einer späteren Zollprüfung aufgedeckt, sind die Konsequenzen gravierend:
- Nachzahlung der hinterzogenen Abgaben für bis zu 10 Jahre rückwirkend.
- Hohe Bußgelder.
- Einleitung von Steuerstrafverfahren gegen die Geschäftsleitung.
Aus unserer anwaltlichen Praxis wissen wir: Oft geschehen diese Fehler nicht aus bösem Willen, sondern aus Unkenntnis. Die Gerichte sehen die Geschäftsführung jedoch in der Pflicht, sich das notwendige Wissen anzueignen oder externen Sachverstand einzuholen. Sich auf die Angaben eines Lieferanten oder Spediteurs blind zu verlassen, schützt vor den Konsequenzen nicht.
Haftungsfalle 2: Mangelnde Produktsicherheit und CE-Kennzeichnung
Nach dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) wird der Importeur rechtlich wie ein Hersteller behandelt. Er trägt die volle Verantwortung dafür, dass die eingeführten Produkte sicher sind und allen EU-Vorschriften entsprechen. Dies gilt insbesondere für die CE-Kennzeichnung. Die Einfuhr nicht-konformer Produkte kann zu sofortigen Verkaufsverboten, teuren Rückrufaktionen und Schadensersatzforderungen führen.
Als plastisches Beispiel aus unserer Praxis: Ein Mandant importierte einen Minibagger aus China. Bei einer Zollbeschau wurde festgestellt, dass wichtige Sicherheitskomponenten fehlten und die CE-Kennzeichnung ungerechtfertigt war. Die Konsequenz: Der Zoll ordnete die Beschlagnahmung und Vernichtung der Maschine an – auf Kosten unseres Mandanten. Ein Totalverlust, der durch eine vorherige Prüfung der Konformität hätte vermieden werden können.
Haftungsfalle 3: Verstöße gegen das Verpackungsgesetz (VerpackG)
Wer Waren in Verpackungen nach Deutschland importiert, gilt als „Erstinverkehrbringer“ dieser Verpackungen. Daraus erwächst die Pflicht zur Registrierung im Verpackungsregister LUCID und zur Beteiligung an einem dualen System (z. B. Grüner Punkt). Wer diese Pflichten ignoriert, riskiert hohe Bußgelder, die direkt an die Geschäftsführung adressiert werden können.
Strategien zur Risikominimierung: Compliance sichern & Prozesse optimieren
Haftungsrisiken lassen sich durch proaktive Maßnahmen und klare Prozesse wirksam managen.
Proaktive Compliance: Das A und O zur Haftungsvermeidung
Richten Sie ein internes Kontrollsystem (IKS) für Ihre Zollprozesse ein. Das klingt komplizierter, als es ist. Es bedeutet, klare Abläufe zu definieren: Wer ist für die Tarifierung zuständig? Wer prüft die Dokumente? Wer gibt die Zollanmeldung frei? Benennen Sie einen Zollverantwortlichen und sorgen Sie für eine regelmäßige Schulung der beteiligten Mitarbeiter in Einkauf und Logistik.
Die Lieferantenauswahl: Sorgfaltspflicht beginnt vor der Bestellung
Fordern Sie von potenziellen Lieferanten alle notwendigen Produktdatenblätter, Zertifikate und Testreports, bevor Sie einen Vertrag unterschreiben. Regeln Sie vertraglich, wer die Verantwortung trägt, wenn der Lieferant falsche Angaben macht. Im Kontext des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes gewinnt diese vorgelagerte Prüfung zusätzlich an Bedeutung.
Dokumentation als Schutzschild: Vollständigkeit und Aufbewahrung
Eine lückenlose Dokumentation ist bei einer Zollprüfung Ihr wichtigstes Schutzschild. Bewahren Sie alle relevanten Unterlagen – von der Rechnung über die Zollanmeldung bis zum Einfuhrabgabenbescheid – für die gesetzliche Frist von 10 Jahren sorgfältig auf.
Intern abwickeln oder externen Partner beauftragen? Eine Entscheidungshilfe
Unternehmen stehen vor der Wahl, die Zollabwicklung selbst zu managen oder externe Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Option 1: Die interne Abwicklung (DIY)
Die Vorteile liegen auf der Hand: Sie behalten die volle Kontrolle, können (vermeintlich) Kosten sparen und bauen internes Wissen auf. Demgegenüber stehen jedoch erhebliche Nachteile: ein hoher Personal- und Zeitaufwand, die Notwendigkeit für tiefes und stets aktuelles Fachwissen und vor allem das volle Haftungsrisiko, das im Unternehmen verbleibt.
Option 2: Der Spediteur / Zollagent als Dienstleister
Ein Spediteur oder Zollagent entlastet Sie operativ und nutzt seine bestehenden Prozesse und seine ATLAS-Software. Das ist bequem, aber Vorsicht: Oft handelt der Dienstleister nur als „Bote“, der Ihre Angaben weiterleitet, ohne sie auf inhaltliche Richtigkeit zu prüfen. Die Verantwortung und die letztendliche Haftung für die korrekte Zolltarifnummer oder den richtigen Zollwert bleiben fast immer bei Ihnen als Importeur. Die Beauftragung eines Agenten ist keine Haftungsfreizeichnung.
Option 3: Der spezialisierte Rechtsanwalt als strategischer Partner
Ein spezialisierter Anwalt bietet mehr als nur die operative Anmeldung. Der Fokus liegt auf der juristischen Prüfung, der strategischen Beratung zur Risikominimierung und der Prävention von Haftungsfällen. Der Anwalt klärt vorab die korrekte Tarifierung, prüft die Verträge und stellt sicher, dass alle Gesetze eingehalten werden. Diese Option ist die richtige Wahl bei komplexen Gütern, hohen Warenwerten, Erstimporten oder wenn im Unternehmen Unsicherheit über die komplexen rechtlichen Pflichten besteht.
Kernerkenntnisse auf einen Blick
- Vorbereitung ist alles: Eine korrekte EORI- und Zolltarifnummer sind das Fundament für jeden erfolgreichen Import.
- Kosten im Blick: Die Gesamtkosten setzen sich aus Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und eventuellen Zusatzabgaben zusammen.
- Haftung ist real: Geschäftsführer können bei Verstößen gegen das Zoll- und Steuerrecht persönlich haftbar gemacht werden.
- Compliance schützt: Ein internes Kontrollsystem und sorgfältige Dokumentation sind Ihr wichtigster Schutz vor Nachzahlungen und Strafen.
- Partnerwahl ist strategisch: Wägen Sie genau ab, ob operative Entlastung (Spediteur) oder juristische Absicherung (Anwalt) für Ihr Geschäft Priorität hat.
Nie wieder ein Dokument vergessen: Holen Sie sich hier unsere umfassende „Checkliste aller notwendigen Importdokumente“ als kostenlosen Download.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Warenimport
Wer haftet bei Fehlern im Importprozess?
Grundsätzlich haftet immer das importierende Unternehmen als Zollschuldner. Allerdings kann die Geschäftsführung bei Organisationsverschulden oder grober Fahrlässigkeit persönlich mit ihrem Privatvermögen haftbar gemacht werden, insbesondere für nicht entrichtete Zölle und Steuern.
Was muss ich bei der Einfuhr nach Deutschland beachten?
Sie müssen vor allem eine EORI-Nummer besitzen, die korrekte Zolltarifnummer für Ihre Ware kennen und alle notwendigen Dokumente wie Handelsrechnung und Frachtpapiere vorlegen. Zudem müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Produkte den EU-Sicherheitsstandards (z.B. CE-Kennzeichnung) entsprechen und Sie Pflichten aus dem Verpackungsgesetz erfüllen.
Wie lange dauert eine Importverzollung?
Eine elektronische Standard-Verzollung ohne Beanstandungen kann innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen sein. Kommt es jedoch zu einer Dokumentenprüfung oder einer Warenbeschau durch den Zoll, kann sich der Prozess um mehrere Tage oder im Problemfall sogar Wochen verzögern.
Welche Konsequenzen drohen bei der Einfuhr nicht konformer Produkte?
Die Konsequenzen reichen von einer Verweigerung der Einfuhr über die Anordnung von Nachbesserungen bis hin zur Beschlagnahmung und Vernichtung der Ware auf Kosten des Importeurs. Zudem können empfindliche Bußgelder und zivilrechtliche Haftungsansprüche drohen.
Kann ich die Zollanmeldung selbst machen?
Ja, theoretisch können Sie die Zollanmeldung selbst über eine zertifizierte ATLAS-Software durchführen. Aufgrund der hohen Komplexität und des Haftungsrisikos wird jedoch den meisten Unternehmen, insbesondere Anfängern, empfohlen, einen spezialisierten Dienstleister oder Rechtsanwalt damit zu beauftragen.
Fazit: Machen Sie Ihren Import zur sicheren Erfolgsgeschichte
Der Import von Waren aus Drittländern ist kein undurchdringlicher Dschungel, sondern ein strukturierter Prozess, der mit dem richtigen Wissen und der richtigen Vorbereitung sicher gestaltet werden kann. Mit den Informationen aus diesem Leitfaden sind Sie in der Lage, die richtigen Fragen zu stellen, Risiken frühzeitig zu erkennen und fundierte Entscheidungen für Ihr Unternehmen zu treffen. So wird der Import von einer gefühlten Bedrohung zu einer kalkulierbaren Chance.
Wenn Sie komplexe Importvorhaben planen, eine juristische Prüfung Ihrer bestehenden Prozesse wünschen oder die persönliche Haftung als Geschäftsführer nachhaltig ausschließen wollen, steht Ihnen unser Team von O&W Rechtsanwälten zur Seite. Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Erstberatung.
Über den Autor
Dr. Tristan Wegner ist Rechtsanwalt und Partner bei O&W Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Seit über 13 Jahren berät er mittelständische Unternehmen zu allen Fragen des Zollrechts, der Importabwicklung und des Außenwirtschaftsrechts. Sein Fokus liegt darauf, für seine Mandanten rechtssichere und pragmatische Lösungen zu entwickeln, die teure Fehler und persönliche Haftungsrisiken für die Geschäftsführung vermeiden.
Dieser Artikel wurde am 3. September 2025 erstellt. Er wurde am 06. September 2025 aktualisiert
Ihr Ansprechpartner
Dr. Tristan Wegner ist seit 2013 als Rechtsanwalt im internationalen Handels- und Transportrecht tätig und hat über 10 Jahre Erfahrung. Er ist Fachanwalt für Transport- und Speditionsrecht. Er ist geschäftsführender Partner der Kanzlei. Herr Dr. Wegner war für eine international führende Kanzlei im Zoll– und Außenwirtschaftsrecht sowie für die Zollfahndung tätig und hat zum internationalen Handel promoviert. Rechtsanwalt Dr. Wegner ist regelmäßig in der Fachpresse und veröffentlicht Aufsätze. Er ist Mitglied im Versicherungswissenschaftlichen Verein Hamburg, der Deutschen Initiative junger Schiedsrechtler (DIS40) sowie dem Europäischen Forum für Außenwirtschaft, Verbrauchsteuern und Zoll, dem Verein für Seerecht und der GMAA. Er ist zudem Dozent und Lehrbeauftragter an der Universität Hamburg.